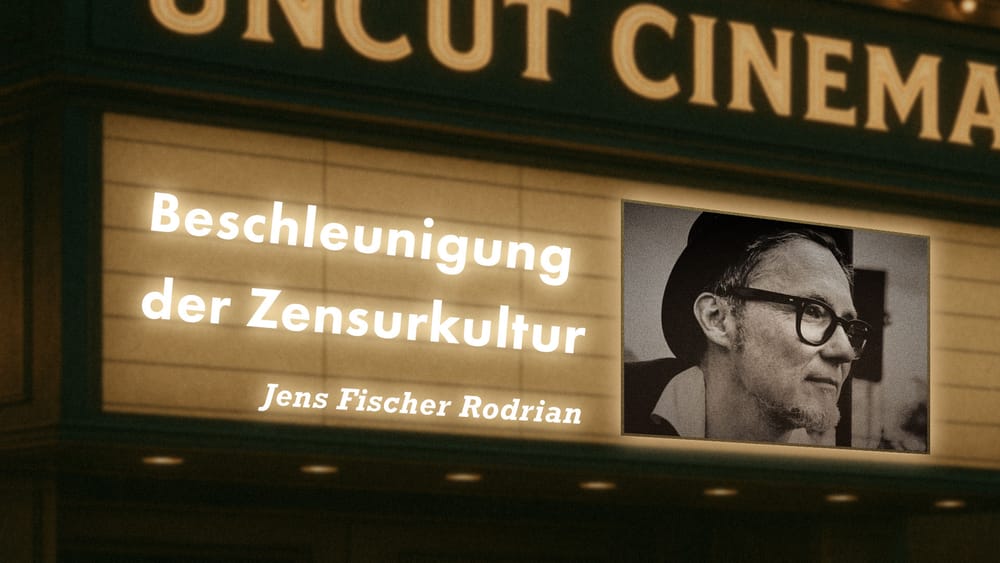Zum DVD-Start von „Der Meister und Margarita“.
Warnung: In diesem Podcast wird nach Herzenslust gespoilert.
“Die Lyrische Beobachtungsstelle” von Paul Clemente.
Deutschland 1914. Der erste Weltkrieg tobt. Ein Dienstmädchen bittet Rosa Luxemburg um einen Lektüre-Tipp. Die drückt ihr den Tolstoi-Roman „Anna Karenina“ in die Hand. „Aber“, stammelt das Mädchen, „alles Russische ist doch jetzt verpönt.“ Daraufhin die Sozialistin: „An so einen Unsinn wirst du doch nicht glauben!“ - Eine Szene aus dem Rosa Luxemburg-Biopic der Regisseurin Margarethe von Trotta.
Mehr als hundert Jahre später: 2022. Wieder steht in Europa ein Krieg vor der Tür. Deshalb fordert Bundespräsident Frank Walter Steinmeier von der hiesigen Bevölkerung: Man müsse Abschied nehmen vom bisherigen „Blick auf Russland“. Auch „wenn viele Bürger unseres Landes sich Russland und seinen Menschen verbunden fühlen, russische Musik und Literatur lieben.“ Aber der Krieg mit der Ukraine fordert eine klare Positionierung gegen Russland. Wieder einmal.
Diesmal ist es kein Tolstoi-Roman, sondern ein Kinofilm, der kriegsbedingte Aversions-Appelle unterläuft. Die Rede ist von „Der Meister und Margarita“, einer Neuverfilmung des Bulgakow-Romans. Die spielte in Russland zwei Milliarden Rubel, also fast 21,5 Millionen Euro ein, sorgte für einen Kassenrekord. Auch in Deutschland war sie 2025 der erfolgreichste Filmstart im Bereich der Arthouse-Kinos. Hinzu kommt, dass ein deutscher Schauspieler – August Diehl – eine der beiden Hauptrollen übernahm und das Sujet deutliche Inspiration durch Goethes „Faust“-Dichtung aufweist: Von Mephisto bis zur Walpurgisnacht. Kurzum: ein deutsch-russisches Kulturwerk, jenseits tagespolitischer Kriegsrhetorik.
Jetzt startet der Film auf DVD und lässt sich streamen. Einige Propaganda-Medien versuchten Schadensbegrenzung und erklärten, der Film enthalte versteckte Kritik am Putin-Regime. Wahrscheinlich richtig, aber er spiegelt ebenso Tendenzen westlicher Polit-Kultur.
Wie schon angedeutet, ist diese Adaption die dritte Verfilmung des Romans: Neben einer TV-Mini-Serie gab es 1972 eine italienisch-jugoslawische Fassung. Deren Soundtrack komponierte Ennio Morricone. Moskau wirkte darin wie eine trübe Kleinstadt. Konträr dazu das Remake: In ihm ist die russische Hauptstadt eine architektonische Dystopie: Ein dunkles Metropolis aus gigantischen Bauten. Steinmonster, auf riesigen Plätzen postiert, von Scheinwerfern angestrahlt. Dagegen: Die Kellerwohnung des Helden, des Dichters, des „Meisters“: Voll gepackt mit Büchern und einer antiken Büste. Angeblich ein Bildnis des Pontius Pilatus. Der ist auch Hauptfigur im neuen Bühnendrama des Dichters: Über die Begegnung zwischen Jesus und dem römischen Statthalter. Wobei der Nazarener den Römer durch kluge Antworten reichlich verwirrt. Die Proben zu dem Drama laufen auf Hochtouren, der Premierentermin rückt vor. Da heißt es plötzlich: Alles stoppen. Kulissen abbauen. Schauspieler nach Hause. Das Stück ist abgesetzt. Keine Widerrede.
Noch am gleichen Tag folgt ein Schauprozess. Ort: Im Haus der Schriftstellervereinigung: Ein Kritiker wirft dem Dichter staatsfeindliche Propaganda vor. Jesus kritisiere darin die Gewalt des Staates. Aller Staaten. Also auch Russland, die Sowjets, die Diktatur des Proletariats. Das könne man nicht hinnehmen. Ein weiterer Kritiker tarnt seinen Zensurvorstoß als Hilfsangebot: Man müsse den Autor unterstützen. Damit er den „richtigen Weg“ findet. Der Verleger des „Pilatus“ übt Selbstkritik: In der Form hätte das Drama nie erscheinen dürfen. Sein Vorschlag: Der Dichter solle es überarbeiten. Der aber weigert sich. Will nicht nachgeben. Die Cancel-Culture zieht ihr Fazit: Der Meister wird aus der Schriftstellervereinigung entlassen.
Michael Bulgakow schrieb die Romanvorlage während der Stalin-Ära. Gedruckt wurde sie erst 1966, 26 Jahre nach seinem Tod. 2025 erinnert der Schauprozess im Autorenverband an Cancel-Tribunale. Die werden meist online geführt und keineswegs nur gegen Autoren, gegen Kunstwerke, sondern auch gegen Postings in sozialen Netzwerken. Auch hier bleibt dem Angeklagten nur: Selbstkritik oder Ausschluss. Es ist nicht ohne Witz, dass die konformistische Taz dem Film „jede Relevanz für die Gegenwart“ absprach, ihn als Produkt des russischen Mainstreams abtat.
Eine weitere Gestalt des Films ist der deutsche Professor Woland. Der ist Mephisto persönlich. Am Patriarchenteich trifft er auf Massolit, den Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes. Der glaubt an Fortschritt und Machbarkeit: Tod sind alle Götter, jetzt ist der Mensch Herrscher und Lenker seines Geschicks. Woland erklärt diese Selbsteinschätzung für falsch und überheblich. Gar nichts habe der Mensch im Griff. Er, Massolit, werde bald durch Enthauptung sterben. Empört verlässt der das Gespräch, um nach wenigen Schritten auszurutschen und von der Straßenbahn geköpft zu werden. - 1928, im Entstehungsjahr des Romans, war dieses Szenario ein einsames Nein gegen Geschichtsoptimismus und Machbarkeitswahn. Heute hingegen, wo dem Menschen die eigenen Konstrukte vielfältig um die Ohren fliegen, wo er weder Technik noch Ökonomie im Griff hat, erscheint solch Widerspruch wesentlich glaubwürdiger.
Die Handlung von „Der Meister und Margarita“ besteht aus Rückblenden, Erinnerungen des Dichters, niedergeschrieben in einer Psychiatrie. Dort landeten zahllose Regime-Gegner während der Stalin-Ära. Die logische Begründung: Wer diese Politik ablehnt, der muss „verrückt“ sein. Hier, an dieser Stelle, könnte man einwenden: Okay, Cancel-Culture und zerbrochener Fortschrittsglaube sind auch Gegenwartsthemen, aber psychiatrische Zwangseinweisung aus politischen Gründen: Das ist doch wirklich vorbei. Oder? - Nun, das Wegsperren schon. Aber die psychologische Kategorisierung von Regierungskritikern keineswegs. Erinnern Sie sich: Während der Lockdown-Jahre wurden in Mainstream-Medien regelmäßig Seelenklempner interviewt. Die sollten das absonderliche Verhalten der Querdenker „analysieren“.
Besonders peinlich: Der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth. Der unterteilte die Bürger während der Lockdown-Jahre in potentiell Erziehbare und Unbelehrbare: „Die meisten Menschen sind leicht bei der Stange zu halten, 80 Prozent brauchen da gelegentlich nur eine kurze Auffrischung. Und die Überängstlichen, das sind vielleicht zehn Prozent, schaden der Sache ja nicht. Wirklich gefährlich sind die letzten zehn Prozent, die sogenannten Sensation Seekers.“ Das seien „Erlebnishungrige“, abgestumpfte Adrenalin-Junkies. Die würden nicht durch kritische Argumente, sondern durch Langeweile angetrieben. Roths Folgerung: „Die kann man zum größten Teil nur abschrecken. Aber wiederum zehn Prozent aus dieser Gruppe beeindruckt gar nichts. Die muss man eventuell einsperren, bei aller humanistischen Gesinnung.“ Da haben wir das Modell: Die Ablehnung politischer Entscheidungen, unfehlbar und alternativlos, verweist auf eine gestörte Psyche. Bei denen hilft nur noch Knast.
Es ist eine Unart, Filme mit literarischen Vorlagen zu vergleichen. Trotzdem soll das hier, beim „Meister und Margarita“, kurz geschehen. Allerdings nur in Bezug auf das Finale. Das findet im Film keine angemessene Verdeutlichung: Nach dem Tod des Dichters und seiner Muse Margarita kommen beide nicht in den Himmel. Denn dort herrscht Licht. Aber die Zwei haben Frieden verdient. Und den gibt es nur im Dunkel, nur im Versteck. Im Jahrzehnt totaler Durchleuchtung, restloser Transparenz ist der Rückzug ins Dunkle, Versteckte wirklich eine Erlösung.
+++
Dank an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Bild: Eine Illustration, inspiriert vom Roman „Der Meister und Margarita“. Die Szene zeigt Margarita, eine weiße Frau, die einen Umhang trägt, der elegant über ihre Figur fällt. Sie unterhält sich mit Woland.
Bildquelle: Shutterstock AI/ shutterstock
+++
Ihnen gefällt unser Programm? Machen wir uns gemeinsam im Rahmen einer "digitalen finanziellen Selbstverteidigung" unabhängig vom Bankensystem und unterstützen Sie uns bitte mit der:
Spenden-Kryptowährung „Nackte Mark“: https://apolut.net/unterstuetzen/#nacktemark
oder mit
Bitcoin: https://apolut.net/unterstuetzen#bitcoin
Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier: https://apolut.net/unterstuetzen/
+++
Bitte empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie gerne unsere Inhalte in den Sozialen Medien. Sie haben hiermit unser Einverständnis, unsere Beiträge in Ihren eigenen Kanälen auf Social-Media- und Video-Plattformen zu teilen bzw. hochzuladen und zu veröffentlichen.
+++
Abonnieren Sie jetzt den apolut-Newsletter: https://apolut.net/newsletter/
+++
Unterstützung für apolut kann auch als Kleidung getragen werden! Hier der Link zu unserem Fan-Shop: https://harlekinshop.com/pages/apolut